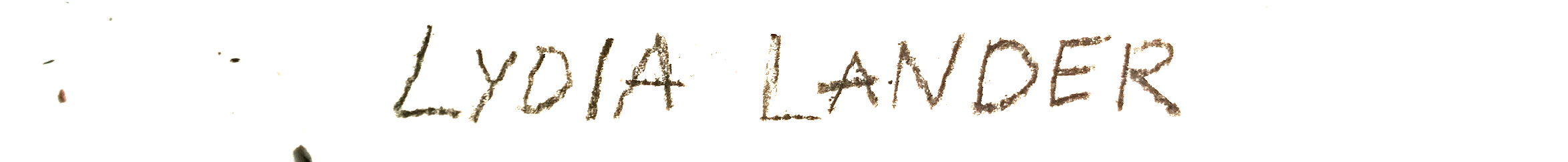Über Ausstellungen und Projekte

Gastbeitrag bei billerundpahlenberg, 2024.
Über mein Buch „Universität+Stadt Vechta, Menschen unterwegs“, Sonderband 6 der Vechtaer Universitätsschriften, hrsg. von Wilfried Kürschner, Joachim Kuropka, Hermann von Laer
„Clint Eastwood und die Große Straße“, Oldenburgische Volkszeitung, 30. April / 1. Mai 2019
„Findlingsgarten“ Ausstellung im Rathaus Grimma
Übers Zeichnen - Film auf Muldental-TV (3 Minuten), 24. Juli 2018
„Menschen haben es ihr besonders angetan“ - Leipziger Volkszeitung, 13. Juli 2018
Ausstellung im Kunstkabinett der Volksbank Stendal
Für den Oberbürgermeister - Altmark Zeitung, 13. Dez. 2017
Internationales Pleinair in Schwedt
Zwölf Künstler - Märkische Oderzeitung, 24. Juli 2017
Künstler im Wetterbericht - Video im Rundfunk Berlin-Brandenburg
Als Artist in Residence in Vechta
„Lydia Lander geht auf Charakterenfang“ - Nordwest-Zeitung, 20. April 2017
Gestatten - Film auf Vechta-TV (3 Minuten), 9. Febr. 2017
Meine Zeichnung auf dem Cover vom „Universum“ - Docplayer: UniVersum Ausgabe 05/2017
Ankündigung - Oldenburgische Volkszeitung, 9. Febr. 2017
Entscheidung der Jury - Nordwest-Zeitung, 9. Febr. 2017
Ausstellung in Brandenburg
„Die Menschen sind komponiert“ - Märkische Allgemeine Zeitung, 3. Nov. 2015
Kein Problem, nur kleine Korrekturen:
Ich verehre japanische Holzschnitte, besonders von Hokusai, Hiroshige und Utagawa Kuniyoshi. Der ein oder andere Reporter berichtet von chinesischen Holzschnitten, vielleicht aus versehentlicher Verwechslung mit chinesischer Reibetusche, die ich zu aller Verwirrung auch noch verwende.
Zur LVZ in Grimma: Ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich zu einer bestimmten Künstlerszene gehören möchte. Welchen Sinn aber sollte es ergeben, sich mangels einer bestimmten Szene an den Vereins-Vorstand in Grimma zu wenden, wie behauptet wird? Zur dortigen Ausstellung im Rathaus kam es eher so: Und zwar herzlichen Dank an Frau Eichhorn vom Förderkreis, dass sie mich angesprochen und mit Nachdruck dazu bewegt hat, vorstellig zu werden. Ohne sie gäbe es die Ausstellung nicht
Eine größere Korrektur: Gendern und Quasi
Im Gastbeitrag bei billerundpahlenberg verwenden die beiden Autorinnen meinen schriftlich eingereichten Text und verfälschen ihn bezüglich zweierlei Dinge:
1.) Sie gendern ihn bis hin zur Geschichtsklitterung. Ich hätte demnach gesagt: In Maler*innen-kreisen kursiert eigentlich der Satz „Maler*in male, rede nicht“. So einen Satz habe ich noch nie gehört, er kursiert überhaupt nicht. Ich habe aufgrund der Bekanntheit darauf verzichtet, zu erwähnen, dass hier Max Beckmann zitiert wird, er hat nicht gegendert. Seine Aussage nun zu gendern, als hätte er es so gesagt, heißt, der Vergangenheit eine gendergerechte Sprache zu unterstellen und anzudichten. Abgesehen davon, dass es schlicht falsch ist, hat es einen widersprüchlichen Effekt: Denn wenn Beckmann und alle Ahnen bereits queerfreundlich und genderbewusst gesprochen hätten, müsste der sogenannte alte weiße Mann rehabilitiert werden. Die ganze Debatte sägt sich hier selbst den Ast ab.
Nach meiner Alltagserfahrung legen aber auch heute die meisten Leute kein Gewicht darauf, bei jedem Thema immer zusätzlich die sexuelle Orientierung oder vielfältige Geschlechtsausprägung der Akteure zu betonen und so vom Gegenstand abzulenken – geschweige denn, historische Vorbilder zu korrigieren und zu verfälschen. Sondern: In Malerkreisen kursiert eigentlich der Satz „Maler male, rede nicht“.
2.) Ebenfalls halten die Autorinnen das Wort „quasi“ für unverzichtbar, und da es bei mir fehlte, verbessern sie mich entsprechend. Das Wort war mir schon vorher unsympathisch, und es gehört niemals in mein Vokabular. Hier entfremdet es sich mir noch einmal mehr, da es an komischster Stelle für wichtig befunden wird, nämlich:
So sind zeichnendes Beobachten und schreibendes Beobachten quasi wie verschiedene Seh- und Denk-Organe.
Lateinisch quasi heißt bereits wie, sodass es hier heißt: wie wie. Diese sinnlose Dopplung und dass der Satz dadurch sehr unästhetisch wird, werden in Kauf genommen. Dass sonst keinerlei Ergänzungsbedarf bei tiefgründigen Themen bestand, aber dieser Einschub nötig war, räumt dem quasi eine außerordentlich hohe, übergeordnete Bedeutung ein, die mir leider nicht bekannt ist, und über die ich nun nachdenke.
Erfahrungsgemäß wird dem Wort von einer bestimmten Schicht Leute in jedem Satz ständig gehuldigt, ein Stil-Statement, Code.
Vermutlich ist es gut gemeint, mich in den Kreis der gehobenen quasi-Anhänger aufzunehmen. Aber ich wurde nicht gefragt – so wird es zur imperialistischen Mentalitäts-Aufstülpung, zur sprachlichen Einverleibung, zum aufgedrängten Zugehörigkeitsbekenntnis. Vielleicht auch ein Ost-West-Konflikt?
Bei mir weckt es die Vorstellung, als müsse ein Europäer einem Eingeborenen beibringen, manierlich mit Messer und Gabel zu essen. So scheint den Autorinnen mein formulierter Gedanke zu rauh, unzumutbar, und muss er durch quasi – es bedeutet auch „in minderem Grade wie“, „beinahe wie“ – entschuldigt, verweichlicht und verwässert werden.
Sonst wäre jemand vor den Kopf gestoßen oder würden Gefühle verletzt. Quasi-Sprachler pflegen oft zusätzlich mit den Fingern Anführungsstriche in der Luft zu markieren, um sich von ihren Formulierungen sorgsam zu distanzieren. Sprach-Scham, Sprach-Verurteilung, Sprach-Reinwaschung. Danach sind sie unangreifbar, haben sie immer Recht, ist jede Diskussion obsolet, weil jede These ohnehin nicht so gemeint ist.
Korrigiert werde ich hier auch nicht durch Diskussion, sondern indem mir die Distanzierung kurzerhand selbst in den Mund gelegt wird. Ich habe es quasi nicht so gemeint. Nur mit quasi kann man die Metaphern so durchgehen lassen. Aber doch meine ich es so:
Zeichnendes Beobachten und schreibendes Beobachten sind wie verschiedene Seh- und Denk-Organe.
Der Trotz verleitet mich zu der Idee: Sie sind verschiedene Seh- und Denk-Organe.